20 Studierende des Fachs Geschichte befassten sich in einem Seminar mit der Rolle der Universität im Nationalsozialismus. Mit Hilfe zahlreicher Dokumente, die im Universitätsarchiv vorliegen, tauchten sie ein in das Leben der Rektoren, Lehrenden und Studierenden aus dieser Zeit.
Die Ideologie des Nationalsozialismus machte vor den Toren der Hochschulen nicht Halt: Der nationalsozialistische Staat strebte ab 1933 an, diese hinsichtlich politischer und ideologischer Ausrichtung zu homogenisieren, wenngleich es für Lehre und Forschung kein genuines NS-Hochschulprogramm gab. Die angestrebte Gleichschaltung führte aber zu Eingriffen in die Struktur der Hochschulen und das Beamtenrecht. Die Freiheit von Forschung und Lehre wurde eingeschränkt. Jüdische Akademikerinnen und Akademiker sowie Studierende wurden aus dem Universitätsleben ausgeschlossen und verfolgt. Zwar fand nach dem Zweiten Weltkrieg auch an Universitäten ein Entnazifizierungsprozess statt, dennoch blieben Fragen nach Kontinuität und Aufarbeitung des Nationalsozialismus in der akademischen Landschaft nicht nur relevant, sondern auch oftmals unbeantwortet. „Unter den Talaren – Muff von 1000 Jahren“ ist bis heute eine der bekanntesten Kernparolen der westdeutschen Studentenbewegung der 1960er Jahre, die unter anderem vehement eine Aufarbeitung der NS-Zeit – nicht nur an den Hochschulen – forderte. Etwa seit den 1980er-Jahren findet eine intensivere Auseinandersetzung deutscher Hochschulen mit ihrer nationalsozialistischen Vergangenheit statt. Auch die Universität Bamberg beschäftigt sich immer wieder mit diesem Abschnitt ihrer Historie – jüngst in einem Seminar unter dem Titel Die Stadt Bamberg und ihre Universität im Nationalsozialismus, 1933–1945.
Kritische Auseinandersetzung mit Universitätsgeschichte
Rund 20 Studierende des Fachs Geschichte nahmen an dem Seminar im Wintersemester 2024/25 teil. Ziel war es, ein gemeinsames Dossier zu erstellen, in dessen Mittelpunkt die Aufarbeitung der Geschichte der Philosophisch-Theologischen Hochschule Bamberg (PTH) als Vorläuferinstitution der heutigen Otto-Friedrich-Universität Bamberg während der Zeit des Nationalsozialismus steht. Die Studierenden beschäftigten sich in Kleingruppen vor allem mit den unterschiedlichen Statusgruppen – Rektoren, Professoren, Studierende – sowie mit den Einflüssen von Staat und Kirche auf die Institution. Das Dossier bildet die Grundlage für eine Webseite der Universität. Das Seminar kombinierte verschiedene didaktische Formate: Workshops, quellenkundliche Übungen und Gruppenarbeiten im Universitätsarchiv. Prof. Dr. Sabine Freitag (im Titelbild: hinten links), Inhaberin des Lehrstuhls für Neuere und Neueste Geschichte unter Einbeziehung der Landesgeschichte, leitete das Seminar und fasst zusammen: „Mit den Ergebnissen ihrer Nachforschungen leisten die Studierenden einen wichtigen Beitrag zur kritischen Auseinandersetzung der Universität mit der eigenen Geschichte. Bereits zuvor war bekannt, dass die PTH Bamberg während der Zeit des Nationalsozialismus eher unauffällig war. Das konnten auch die Studierenden bei ihren Nachforschungen bestätigen: Es gab weder außergewöhnlich starken Widerstand noch extreme nationalsozialistische Exzesse. Die Studierenden konnten zahlreiche interessante Details zusammentragen, die dazu beitragen, dass wir aus der Vergangenheit lernen und ein Bewusstsein dafür entwickeln können, welche Verantwortung Hochschulen in der Gesellschaft tragen.“
Archivmaterial: Von Ministerialschreiben bis hin zu Postkarten
Die Studierenden konnten während ihrer Recherchen auf zahlreiche unterschiedliche Quellen im Universitätsarchiv zugreifen und werteten einen Teil davon für das Dossier aus. „Uns liegen etwa Ministerialschreiben, Rektoratskorrespondenz, Personal- und Studierendenakten aus dieser Zeit vor“, erläutert Dr. Margrit Prussat, Leiterin des Universitätsarchivs. Hinzu kommen Informationen zu Gremien, zum Lehrbetrieb und zu Organisation und Struktur der PTH. „Die Unterlagen sind unterschiedlich umfangreich. In manchen Bereichen sind uns nur Fragmente geblieben, zu anderen haben wir neben offiziellen Dokumenten auch handschriftliche Notizen, Briefe oder Postkarten“, sagt Prussat. „In welchem Umfang belastendes oder auch Widerstand gegen das NS-Regime ausdrückendes Material während oder nach dem Krieg vernichtet wurde, können wir leider aktuell noch nicht nachvollziehen. Auffällig große Lücken scheint es aber nicht zu geben.“ Zusätzlich zu Teilen des Archivmaterials griffen die Studierenden auf bereits bestehende Literatur zurück, die sich mit der Geschichte der Hochschulen im Nationalsozialismus – und speziell mit der PTH Bamberg – beschäftigt. Was haben sie herausgefunden?

Sonderstatus der PTH
Der nationalsozialistische Staat versuchte, wie auf alle anderen Hochschulen, auch auf die PTH Einfluss zu nehmen und sie gleichzuschalten. Die Philosophisch-Theologischen Hochschulen in Bayern hatten aber einen Sonderstatus: Sie wurden im 19. Jahrhundert für die Ausbildung katholischer Priester vom bayerischen Staat gegründet und waren staatlich getragen. Doch die Kirchen hatten bereits vor der nationalsozialistischen Machtergreifung Mitspracherechte und nutzten diese auch in der NS-Zeit, um staatliche Pläne zu untergraben. So unterschieden sie sich von klassischen Universitäten etwa in der Zusammensetzung der Lehrenden und Lernenden, dem Prozedere der Ernennung der Rektoren und Professoren sowie Ausnahmeregelungen bezüglich des Wehrdienstes. Im Wintersemester 1939/40 wurde die PTH Bamberg vom nationalsozialistischen Staat geschlossen. Begründung: Die Räumlichkeiten würden für die Dauer des Kriegs zur Unterbringung von Volksgenossen und für andere Kriegszwecke benötigt. In der langen Tradition der Universität Bamberg war der Schul- und Vorlesungsbetrieb nur zur Zeit des Nationalsozialismus unterbrochen.

Widerstand der Rektoren
Einflussversuche, insbesondere durch lokale NS-Akteure, wiesen die Rektoren der PTH mehrfach zurück – häufig mit Erfolg. Sie bezogen sich dabei oft auf verwaltungsrechtliche Argumente, wie aus den Akten, die im Archiv vorliegen, hervorgeht. Ein Beispiel, das den Studierenden des Seminars besonders aufgefallen ist: Prof Dr. Peter Maier war von Oktober 1933 bis November 1936 Rektor der PTH. Er wurde im November 1934 von der Gaufilmstelle aufgefordert, die Studierenden der PTH dazu zu verpflichten, Vorführungen staatspolitischer Filme zu besuchen. In seinem Widerspruch berief er sich darauf, dass auf Basis der Verfassung der Hochschulen für den Rektor keine Möglichkeit bestünde, Studierende in Filmvorführungen zu schicken. Auf Maier folgte als Rektor kurz vor Kriegsbeginn Prof. Dr. Benedikt Kraft, der die PTH durch die Zeit ihrer Schließung führte und unter dessen Leitung die PTH als eine der ersten Hochschulen Deutschlands bereits im Oktober 1945 wieder den Vorlesungsbetrieb aufnehmen konnte. Kraft gilt als Wegbereiter der späteren Erhebung der PTH zur Universität.
Nazis in der Professorenschaft?
Im Universitätsarchiv sind, neben Informationen zu den Rektoren, Akten zu Professoren zu finden, die in der NS-Zeit an der PTH tätig waren. Während der Schließung der PTH blieben diese entweder bei vollen Bezügen im Dienst, wurden an andere Lehrorte versetzt oder gingen in den Kirchendienst. Soweit aus den Universitätsakten und weiteren Quellen ersichtlich ist, waren die meisten von ihnen weitgehend unauffällig während des Nazi-Regimes. Den Studierenden fielen bei ihren Recherchen jedoch ein paar Professoren besonders auf: Unter ihnen Prof. Dr. Dr. Ludwig Faulhaber. Er lehrte ab 1925 an der PTH als außerordentlicher Hochschulprofessor für Religionsphilosophie und Apologetik. Nachweislich war er ein starker Gegner des Naziregimes und nie Parteimitglied der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei (NSDAP). Privat und auch an der Hochschule leistete er Widerstand gegen das Regime, weshalb er immer wieder vom Ministerium für Bildung und Kultus ermahnt wurde.
Prof. Dr. Johann Baptist Walz hingegen bezeichnete sich selbst als Nationalsozialisten. Er fand nach dem Ersten Weltkrieg, in dem er verwundet wurde, lediglich Vertretungsanstellungen an Hochschulen. Mit Nachdruck versuchte er, sich auf alle möglichen Lehrstühle zu bewerben und biederte sich den Nazis an, wie die Studierenden bei ihren Archivbesuchen herausfinden konnten. Zum Wintersemester 1937/38 wurde er auf den Lehrstuhl für Altes Testament in Bamberg berufen. Nach dem Krieg verlor er diesen aber und wurde mehr oder weniger in den Ruhestand gezwungen. In der Gesamt-sicht aller vorliegenden Dokumente kommen die Studierenden des Seminars zu dem Schluss, dass Walz mehr ein Opportunist war als ein in seiner Ideologie überzeugter Nationalsozialist.
Rolle der Machtübernahme im Studienalltag
Doch wie erging es den Menschen, die von den Professoren unterrichtet wurden? Aus den Archivalien geht hervor, dass die Studierenden der Theologie in den 1930er-Jahren häufig aus Klöstern, dem Priesterseminar Bamberg und anderen geistlichen Einrichtungen an die PTH kamen. Die Vorlesungsverzeichnisse zwischen 1932 und 1940 sind jeweils in die Philosophische und die Theologische Abteilung gegliedert und listen die angebotenen Lehrveranstaltungen auf. Die Studierenden stellten bei ihren Archivrecherchen fest, dass das Lehrangebot insbesondere zwischen 1933 und 1936 eine starke Kontinuität aufweist. Sie schließen daraus, dass die ideologische Durchdringung der Lehre in Bamberg eher gering war. Hinweise auf nationalsozialistische Propaganda in den Vorlesungen fanden die Studierenden nicht. Nichtsdestotrotz spiegelte sich die Machtübernahme der Nationalsozialisten im Studienalltag wieder. So mischten sich unter die Lehrveranstaltungen auch Gedenkfeiern oder Feiern zur Machtübernahme, zu deren Teilnahme die Studentenschaft verpflichtet werden sollte.
Wenngleich die PTH aufgrund ihrer Fächerstruktur mit Fokus auf katholischer Theologie nicht viele jüdische Lehrende und Studierende anzog, versuchte die NSDAP über die PTH an Informationen aktueller oder ehemaliger Studierender für den Nachweis ihrer arischen Abstammung zu gelangen. Das bezeugt zum Beispiel ein Schreiben des Rasse- und Siedlungsamts, in dem Informationen zu Geburtsdaten und Konfession eines ehemaligen Studenten erfragt wurden. Das Reichsstudentenwerk mit Sitz in Berlin-Charlottenburg, in dem überzeugte Nationalsozialisten agierten, versandte wiederum sogenannte Warnungslisten mit Namen von Studierenden, die gesucht oder aufgefallen waren. Des Weiteren bot das Reichsstudentenwerk die Verbreitung spezieller NS-Studentenliteratur an und verbreitete die beschlossenen Richtlinien für Universitäten, die auch die PTH Bamberg betrafen. Die PTH sammelte die Rundschreiben von und die Korrespondenzen mit dem Reichsstudentenwerk. Aus den Dokumenten im Archiv geht aber auch hervor, dass der Inhalt wohl des Öfteren ignoriert wurde.
Zwischen Studium und Arbeitsdienst
Im Juli 1933 ordnete das Reichsministerium des Innern für alle männlichen Studierenden der ersten vier Semester einen verpflichtenden Arbeitsdienst an, um sie im nationalsozialistischen Sinne zu erziehen. Nach Widerständen, insbesondere durch den Breslauer Kardinal Bertram, wurden Theologiestudenten vom Arbeitsdienst befreit und mussten stattdessen eine Samariterausbildung, organisiert durch die Bischöfe, besuchen. Die Studierenden des Seminars schließen daraus, dass die Theologiestudenten weniger dem nationalsozialistischen Einfluss ausgesetzt waren als Studenten anderer Fächer. 1936 wurde die Arbeitspflicht dennoch auch für Studenten der katholischen Theologie eingeführt. Sie konnten sich vor Ableistung des Dienstes nicht für das Studium immatrikulieren.
Der Luftschutz wurde ab 1938 ein zentraler Bestandteil des akademischen Lebens in Bamberg. Rund 100 Studierende nahmen an einem Luftschutzkurs teil, dessen Ziel es eigentlich war, alle 226 eingeschriebenen Studierenden zu schulen. Ab Mai 1939 wurde die Hochschule zur erweiterten Selbstschutzorganisation erklärt und mit entsprechenden Geräten ausgestattet. Der Luftschutz ersetzte ab 1938 den klassischen Arbeitsdienst. Mit dem Ausbruch des Krieges stieg die Zahl der Beurlaubungsanträge erheblich. Viele Studenten wurden zum Militärdienst einberufen und mussten ihr Studium unterbrechen. Besonders drastisch sind die Zahlen des Wintersemesters 1939/40, wie die Studierenden feststellten. Auch Professoren wurden teilweise zum Kriegsdienst einberufen. Anfragen aus Kriegsgefangenschaft nach Studienmaterialien verdeutlichen das Bestreben vieler Studenten, trotzdem akademisch aktiv zu bleiben. Aus den Archivalien wird ersichtlich, dass die PTH sich bemühte, den Kontakt zu den Studierenden aufrechtzuerhalten. Feldunterrichtsbriefe wurden dabei zu einem wichtigen Medium.
„Die Dokumente, die uns im Universitätsarchiv aus der Zeit des Nationalsozialismus vorliegen, bieten einen wertvollen Einblick in die Geschichte unserer Universität“, sagt Margrit Prussat. „Wir haben bereits einen guten Überblick über das Material. Viele Fragen, die sich aus dem Archivgut ergeben, sind aber noch unbeantwortet und bieten sich an, in weiteren Forschungsprojekten und Abschlussarbeiten erforscht zu werden.“ Clemens Kronast ist einer der Studierenden aus dem Seminar. Er plant, seine Masterarbeit inhaltlich an das Seminar anzuschließen. „Ich wusste vor dem Seminar gar nichts über die Rolle der PTH im Nationalsozialismus“, erläutert Kronast. Das ist jetzt anders: „Für mich war vor allem überraschend, wie unauffällig die PTH war. Insgeheim hofft man ja, dass man bei der Detektivarbeit im Archiv einen sensationellen Fund macht und zum Beispiel bisher unentdeckte Dokumente zu großen Einflussnahmen der Nazis findet.“ Auch wenn der große Fund ausblieb, will Clemens Kronast am Thema dranbleiben: In seiner Masterarbeit will er sich näher mit der Rolle der PTH während des Zweiten Weltkriegs und in der Nachkriegszeit befassen.
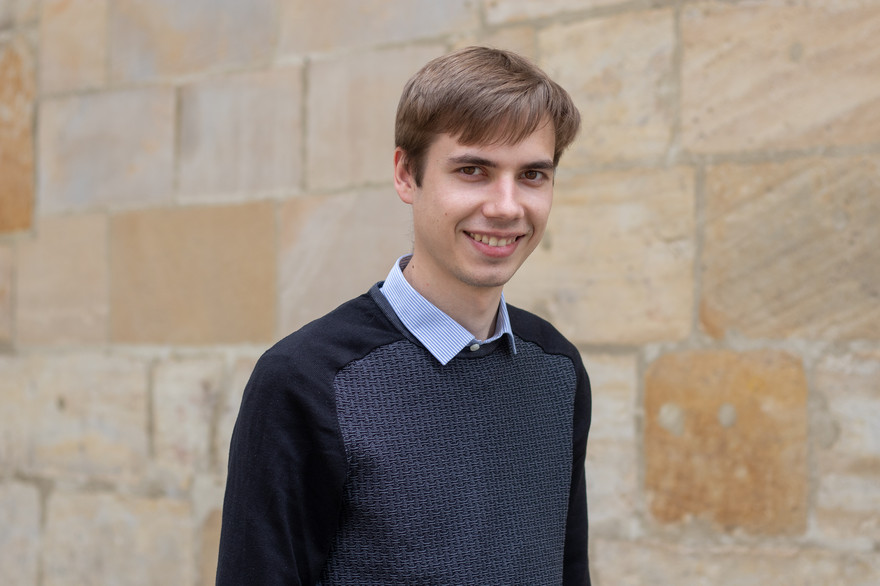
Lesetipps
Das aus dem Seminar entstandene Dossier mit zahlreichen weiteren Informationen ist künftig zu finden unter: www.uni-bamberg.de/arch/uni-geschichte-online/uni-geschichte-entdecken
Pascal Müller, Alumnus der Universität Bamberg, beschäftigte sich zudem in seiner Masterarbeit mit dem Thema „Die Philosophisch-Theologischen Hochschulen Bayerns in der Zeit des Nationalsozialismus mit besonderer Berücksichtigung der Philosophisch-Theologischen Hochschule Bamberg“. Die Publikation aus 2022 ist frei zugänglich unter: https://fis.uni-bamberg.de/handle/uniba/55438
