Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) wird vielfach als zentraler und unabdingbarer Beitrag zur Gestaltung einer nachhaltigen Zukunft verstanden. Auch Universitäten bekennen sich zunehmend zu diesem Bildungsauftrag. Allerdings entfaltet das Konzept seine Wirksamkeit nicht automatisch, sondern bedarf einer kontinuierlichen Reflexion im Hinblick auf gesellschaftliche Entwicklungen. Vor diesem Hintergrund diskutiert dieser Beitrag ausgewählte Herausforderungen von BNE und reflektiert deren Bedeutung für den Hochschulkontext.
Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) bezeichnet eine Bildungskampagne der Vereinten Nationen. Ziel von BNE ist es, Individuen dazu zu befähigen, nachhaltig zu denken, zu entscheiden und zu handeln. Die Zielgruppe beschränkt sich dabei nicht nur auf Schüler*innen, sondern umfasst alle Altersgruppen, weshalb BNE auch für Hochschulbildung unmittelbar relevant ist. Bildung wird dabei explizit als Beitrag zu einer nachhaltigen Entwicklung verstanden und in der Agenda 21, die 1992 verabschiedet wurde, als ein Instrument der Bewusstseinsbildung beschrieben.
Aus erziehungswissenschaftlicher Perspektive wirft diese Instrumentalisierung von Bildung zunächst grundlegende Fragen auf:
Erstens verweist das sogenannte Technologiedefizit der Pädagogik (vgl. Luhmann & Schorr 1982) darauf, dass pädagogisches Handeln nicht in kausaler Weise auf definierte Wirkungen hingesteuert werden kann. Zweitens widerspricht die Vorstellung von Bildung als bloßem Mittel einem Bildungsverständnis, das auf Selbstbestimmung und Mündigkeit zielt. Hinzu kommen umweltpsychologische Ergebnisse, die lediglich einen schwachen Zusammenhang zwischen Bewusstseinsbildung und Verhalten belegen – was die Annahme, dass Bildung automatisch nachhaltiges Handeln nach sich zieht, weiter relativiert.
Im Kontext BNE wird daher diskutiert, dass es vorrangig darum gehen sollte, die Lernenden dazu anzuregen, eigenständig potenzielle Lösungswege für Nachhaltigkeitsprobleme zu erörtern – insbesondere dann, wenn solche Lösungen noch nicht existieren und demokratisch ausgehandelt werden müssen. BNE steht vor der Herausforderung, dass sie Lernende für globale, langfristige und komplex verwobene Nachhaltigkeitsprobleme sensibilisieren soll, obwohl individuelle Wahrnehmung und Handlungsmotivation häufig auf den Nahbereich fokussiert sind und nachhaltiges Verhalten kurzfristig kaum belohnt wird.
Im Folgenden sollen ausgewählte aktuelle Herausforderungen einer BNE in den Blick genommen werden, um einen Einblick in zentrale Spannungsfelder und Voraussetzungen für deren pädagogische Umsetzung zu geben.
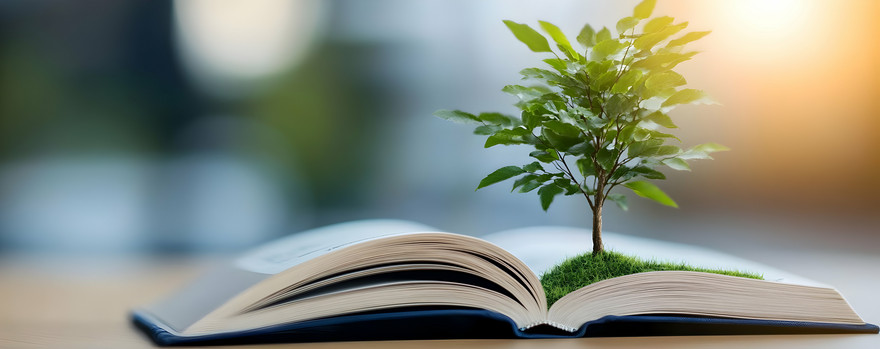
BNE zwischen Gegenwartsorientierung und visionärem Denken
Meist ist eindeutig, was als nicht nachhaltig gilt – Vorstellungen einer nachhaltigen Zukunft reichen aber oft kaum über den Status quo hinaus. Zukünftige Entwicklungen werden zumeist linearisiert aus bisherigen Erfahrungen abgeleitet. So dominiert im Hinblick auf das Mensch-Natur-Verhältnis häufig eine zerstörerische Prognose, während technologische Entwicklungen weitgehend fortgeschrieben werden – ohne beide Entwicklungslinien systematisch aufeinander zu beziehen. Studien deuten darauf hin, dass implizit davon ausgegangen wird, dass technischer Fortschritt das Problem lösen werde und die Folgen von Naturzerstörung kompensieren kann. Eine nachhaltige Entwicklung wird aber kaum ohne positiv besetzte Zukunftsbilder gesellschaftlich getragen werden. Schon jetzt ist eine starke Tendenz in der Bevölkerung zu erkennen, nachhaltige und vor allem klimafreundliche Alternativen als (zu) teuer, unzugänglich und elitär wahrzunehmen. BNE soll in diesem Zusammenhang nicht nur langfristiges, zukunftsgerichtetes Denken fördern, sondern auch die Fähigkeit stärken, Visionen einer nachhaltigen Zukunft zu entwerfen. Universitäten können hier eine zentrale Rolle übernehmen: Sie bieten Freiräume, in denen alternative Zukunftsentwürfe sowohl gedanklich als auch experimentell – etwa in Form von Reallaboren – entwickelt werden können. So können sie zur Etablierung positiver Narrative nachhaltiger Lebens- und Gesellschaftsformen beitragen.

BNE zwischen normativem Anspruch und gesellschaftlichem Dissens
BNE differenziert in ihrer Grundanlage zunächst nicht nach der Zielgruppe. In der konkreten Bildungspraxis ist eine solche Differenzierung jedoch unabdingbar – nicht nur, um an Vorwissen anzuknüpfen, sondern vor allem, um Einstellungen und Lebenswelten angemessen zu berücksichtigen.
Gesellschaftlich lässt sich eine zunehmende Spaltung zwischen Befürwortung und Ablehnung der sozial-ökologischen Transformation beobachten. In der Bevölkerung lässt sich zwar ein gewisser Konsens in Bezug auf die – zugegeben oft sehr abstrakt abgefragte – Relevanz von Nachhaltigkeitsfragen beobachten. Uneinigkeiten bestehen, wie sich die konsensuale Einstellung für Klima- und Umweltschutz oder die Bekämpfung von Armut in die konkreten Handlungspraxen übersetzt, welche konkreten Maßnahmen unterstützt oder nicht unterstützt werden und wer dabei in der Verantwortung steht. Diese Spaltung verläuft dabei keineswegs ausschließlich entlang sozioökonomischer Linien. Vielmehr zeigen aktuelle Befunde (vgl. Eversberg et al., 2024), dass sich insbesondere einkommensschwächere Milieus gemeinsam mit ökonomischen Eliten – deren Kapitalinteressen eng mit erdölbasierten Industrien verknüpft sind – gegen tiefgreifende Transformationsprozesse stellen.
Auch wenn für die Zielgruppe der Studierenden nicht zwingend grundlegende Widerstände gegen die Idee der Nachhaltigkeit zu erwarten sind, sollte eine Hochschulbildung für BNE diese gesellschaftliche Situation nicht ausblenden. Gerade wenn Studierende als zukünftige Multiplikator*innen in Wissenschaft, Politik, Wirtschaft oder Bildung wirksam werden (sollen), ist es notwendig, explizit auch gesellschaftliche Widerstände gegen Nachhaltigkeit in ihrer Komplexität aufzugreifen, denn von einem gesellschaftlichen Konsens mit dieser Idee kann keineswegs gesprochen werden.
Vor diesem Hintergrund muss BNE immer auf die gesellschaftliche Gegenwart bezogen und entsprechend kontextualisiert werden. Damit einher geht auch die Neuausrichtung von Zielen. Diese scheinen derzeit auch darin zu bestehen, Menschen die kurz- bis langfristigen individuellen und gesellschaftlichen Vorteile einer sozial-ökologischen Transformation aufzuzeigen und Vorurteile abzubauen. Dafür bedarf es der Dialogfähigkeit und dialogischer Räume, die bewusst über die Grenzen bestehender sozialer oder akademischer Milieus hinausreichen. Gerade in Anbetracht zunehmender Wissenschaftsfeindlichkeit und der Verbreitung von Desinformationen ist es eine zentrale Aufgabe von Universitäten, den gesellschaftlichen Nutzen von Wissenschaft nachvollziehbar zu verdeutlichen – Aspekte, die im Rahmen der sogenannten Third Mission verankert sind und die aktive Rolle
von Universitäten im gesellschaftlichen Wandel betonen.

Universitäten als Bildungsräume für nachhaltige Entwicklung
Angesichts der skizzierten Spannungsfelder stehen Universitäten vor der Aufgabe, nicht nur Wissen über Nachhaltigkeitsfragen zu vermitteln, sondern diskursive Räume für Reflexion, Diskussion sowie kritisches und visionäres Denken zu eröffnen. Dies erscheint insbesondere angesichts negativer Zukunftsbilder, unklarer Lösungswege sowie politischer und kultureller Widerstände von grundlegender Bedeutung. Die Förderung von Imagination, systemischem Denken, Dialogfähigkeit und demokratischer Handlungskompetenz rückt damit in den Mittelpunkt hochschulischer Bildung. Zukünftig gilt es, verstärkt Brücken zu bauen – sowohl zwischen wissenschaftlichen Disziplinen als auch zwischen Hochschule und Gesellschaft. Hochschulen müssen durch ihre Third Mission eine vermittelnde Rolle einnehmen, um gesellschaftliche Transformationsprozesse nicht nur zu erforschen, sondern auch aktiv zu begleiten und Studierende auf ihre Rolle als Multiplikatorinnen und Multiplikatoren vorzubereiten.

