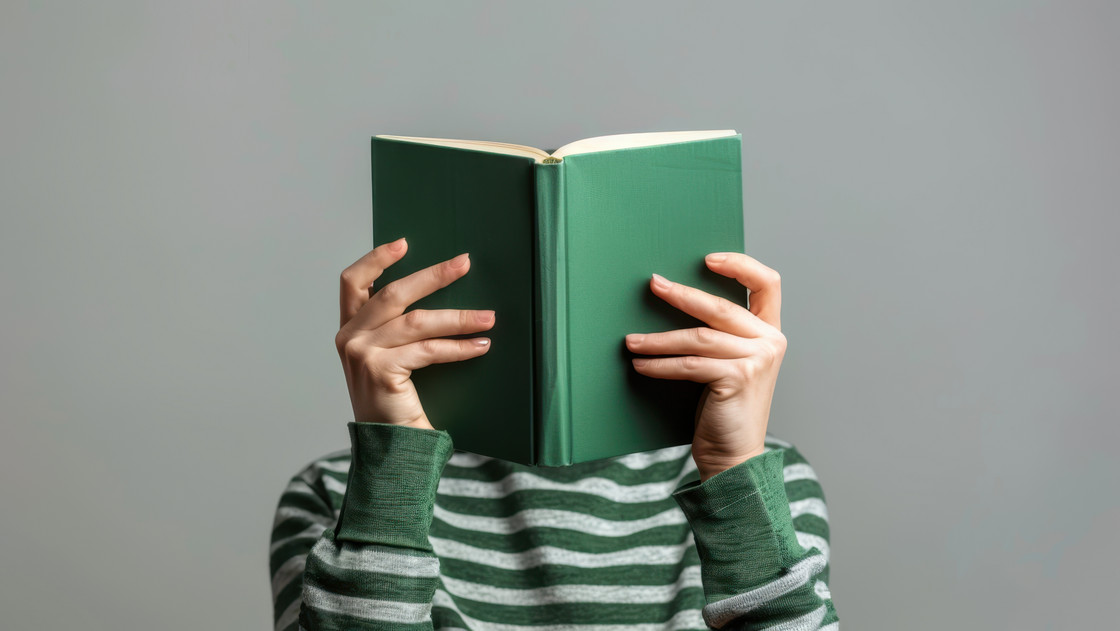In Deutschland ist fast jeder vierte Jugendliche übergewichtig, und rund 30 Prozent der Studierenden leiden an depressiven Symptomen. Wenn gesundheitliche Probleme bereits in der Jugend und im Studium zunehmen, betrifft dies in einer Zeit des demographischen Wandels nicht nur das Wohl der Einzelnen, sondern langfristig auch die Gesellschaft im Ganzen. Die Soziologie kann Antworten auf die Ursachen finden – und Vorschläge zur Verbesserung machen.
In den letzten Jahren hat die Forschung verstärkt den Einfluss sozialer und ökonomischer Ungleichheiten auf die Gesundheit untersucht und dabei gezeigt, dass diese Ungleichheiten sich bereits früh im Leben manifestieren und langfristige gesundheitliche Folgen haben können. Einer der Forscher auf diesem Gebiet ist Prof. Dr. Marvin Reuter, seit 2023 Juniorprofessor für Soziologie, insbesondere Arbeit und Gesundheit, an der Universität Bamberg.
Bereits im Studium hatte er seine ersten Berührungspunkte mit Gesundheitsdaten. So half er bei der Datenanalyse einer Kohortenstudie, die über 25 Jahre Kinder begleitete, um zu untersuchen, welche Allergien sie entwickelten. Bei der Analyse der Daten stellte er fest, dass Kinder aus Familien mit geringem Einkommen häufiger an Asthma erkrankten. Doch warum? In seiner Masterarbeit fand Reuter heraus, dass diese Kinder häufiger in umweltbelasteten Gebieten, in der Nähe verkehrsreicher Straßen oder ohne Grünflächen lebten. Seine Dissertation untersuchte, wie prekäre Arbeitsverhältnisse mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen zusammenhängen.

Gesundheitliche Ungleichheiten beim Übergang ins Erwachsenenalter
An der Universität Bamberg arbeitet Reuter unter anderem mit Daten des Nationalen Bildungspanels (NEPS). Das NEPS sammelt regelmäßig Daten von Tausenden von Teilnehmenden, die über mehrere Jahre hinweg umfangreich zu ihrem Bildungsweg und ihrem sozialen Umfeld befragt werden. Eine Frage im NEPS betrifft die subjektive Einschätzung des eigenen Gesundheitszustands. Die Teilnehmenden werden gebeten, diesen auf einer Skala von „sehr gut“ bis „sehr schlecht“ zu bewerten. „Diese sogenannte „self-rated health“-Frage ist ein einfacher, aber zuverlässiger Indikator für die Wahrnehmung der körperlichen und psychischen Verfassung. Studien belegen, dass die subjektive Gesundheit eng mit objektiven Faktoren wie chronischen Krankheiten und der Lebenserwartung verknüpft ist.“ Weiter führt er aus: „Das ist die Frage des NEPS, die ich nun für verschiedene Gruppen und Fragestellungen untersuche.“
Eine Studie von Reuter befasst sich auf Basis der NEPS-Daten mit gesundheitlichen Ungleichheiten, die während des Übergangs vom Jugend- ins junge Erwachsenenalter in Deutschland entstehen. „Es gibt mittlerweile viele Studien zur Kindergesundheit und zu sozialen Ungleichheiten bei Erwachsenen. Aber diese Übergangsphase dazwischen, also von der Jugend ins Erwachsenenalter, wurde bisher relativ wenig untersucht.“ Der Fokus der Untersuchung liegt darauf, wie sich der Bildungsstand der Eltern auf die Gesundheit der Jugendlichen und jungen Erwachsenen auswirkt und welche Faktoren diese Beziehung erklären.
Bildungsstand beeinflusst Gesundheit
Die deskriptiven Analysen zeigen deutliche Unterschiede in der selbst eingeschätzten Gesundheit und im Übergewicht zwischen Jugendlichen aus Familien mit unterschiedlichem Bildungsstand. Jugendliche aus Haushalten mit niedrigem Bildungsniveau haben weniger Jahre an Schulbildung bei häufigerem Sitzenbleiben, weniger Jahre im Studium, rauchen mehr bei weniger sportlicher Betätigung. Zudem liegt der Anteil an Personen mit Überge-wicht – gemessen am ebenfalls abgefragten BMI – bei Jugendlichen aus Haushalten mit niedrigem Bildungsstand bei 20 Prozent im Vergleich zu 15,5 Prozent unter Jugendlichen höhergebildeter Eltern.
Die gesundheitlichen Ungleichheiten nehmen dabei während des Übergangs ins Erwachsenenalter zu. Jugendliche aus weniger gebildeten Haushalten starten bereits mit schlechterer Gesundheit in die Jugend, und diese Unterschiede vergrößern sich mit zunehmendem Alter weiter. Übergewicht stieg unter allen Jugendlichen an, aber bei Kindern von niedriggebildeten Eltern war der Anstieg stärker. Besonders auffällig ist, dass die gesundheitlichen Unterschiede zunächst im späten Jugendalter leicht abnehmen, aber im jungen Erwachsenenalter wieder zunehmen, insbesondere im Hinblick auf Übergewicht.
Von den Eltern und Freunden abgeschaut …
Mögliche Gründe für die ungleiche Gesundheit liegen laut Reuter beispielsweise in den Sozialisationserfahrungen der Jugendlichen im Elternhaus oder auch in den Schulklassen. Jugendliche aus Haushalten ohne akademischen Hintergrund rauchen häufiger und sind seltener körperlich aktiv. Diese Verhaltensweisen wirken sich negativ auf ihre Gesundheit und das Körpergewicht aus.
Psychosoziale Faktoren wie chronischer Stress und ein geringes Selbstwertgefühl erklären ebenfalls einen bedeutsamen Teil der gesundheitlichen Ungleichheiten. Und natürlich spielt auch die Arbeitswelt eine wichtige Rolle. In einer Studie mit jungen Erwerbstätigen in Deutschland fand Reuter heraus, dass Beschäftigte mit geringerer Schulbildung deutlich häufiger über körperliche und psychische Beschwerden berichten und im Durchschnitt mehr Krankheitstage aufweisen. Die Gründe dafür liegen zu einem beachtlichen Teil in den Arbeitsbedingungen selbst. So üben junge Beschäftigte ohne Abitur häufiger körperlich belastende Tätigkeiten aus, berichten aber auch über höhere psychosoziale Anforderungen wie Arbeiten unter Zeit- und Leistungsdruck, fehlende Entscheidungsspielräume sowie Wochenend- und Schichtarbeit.

„Arme Menschen haben keine Lobby“
Auch das Sporttreiben und das generelle Gesundheitsbewusstsein sind von Bildung abhängig, so Reuter. Aus den Daten lässt sich schließen, dass Jugendliche aus bildungsnahen Haushalten eher die Bedeutung von Sport und gesunder Ernährung erkennen und in ihren Alltag integrieren, während Jugendliche aus bildungsfernen Haushalten seltener diese Verhaltensweisen übernehmen.
Neben der Sozialisation spielt das Einkommen eine entscheidende Rolle für die Gesundheit. Reuter erklärt: „Es gibt Studien, die sehr klar zeigen, dass gesunde Ernährung Geld kostet – und zwar mehr Geld als ungesunde Ernährung. Für eine Person, die wenig Geld hat, kann es logisch und sinnvoll sein, sich kalorienreich und ungesund zu ernähren, weil sie einfach länger satt bleibt.“
Reuter hat sich Aspekte wie das Selbstwertgefühl angeschaut, aber auch Stresserleben, Sitzenbleiben und Jugendarbeitslosigkeit. Von all diesen Faktoren sind Kinder von Eltern mit einem niedrigeren Bildungsniveau häufiger betroffen. „Das stimmt mich sehr nachdenklich, sogar traurig. Sie haben von allen Aspekten, die gut sind, weniger, und von allen Aspekten, die schlecht sind, mehr.“ Wenn Studien bei bestimmten Berufsgruppen ein erhöhtes Krankheitsrisiko feststellen, so Reuter, setzen sich Interessengruppen für eine Änderung ein. „Doch arme Menschen haben keine Lobby!“

Studieren mit Nebenwirkungen?
Das Ergebnis, so ernüchternd es auch sein mag, war keine Überraschung, sondern bestätigte vorhandene Beobachtungen. Doch das ist nicht immer so. „Zu meiner Studienzeit hatte ein sehr guter Freund von mir Jura studiert“, erklärt Reuter. Dieser berichtete, dass seine Kommilitoninnen und Kommilitonen zunehmend gesundheitliche Probleme entwickelten. „Wir haben dann herumphilosophiert, ob das Jurastudium diese Leute irgendwie krank gemacht hat“, erzählt der Soziologe. Diese Frage nahm er nun zum Anlass, die Gesundheitsdaten des NEPS auch in der Gruppe der Studierenden zu untersuchen.
In der Studie „Macht Ihr Studienfach Sie krank?“ untersucht Reuter die bisher wenig erforschten horizontalen Bildungsunterschiede der Studierenden. „Studierende haben ja in der Regel alle ein hohes Bildungsniveau, unterscheiden sich zwischen den verschiedenen Fächergruppen aber dann doch in den fachspezifischen Qualifikationen und Interessen, ihren Tätigkeiten im Studium und den Möglichkeiten auf dem Arbeitsmarkt.“ All dies, so seine Hypothese, könne eine Rolle für die Gesundheit spielen. Ihn interessierten dabei zwei Aspekte: Inwieweit unterscheidet sich die Gesundheit von Studierenden in verschiedenen Fächern zu Beginn des Studiums? Und zweitens: Wie verändert sich die Gesundheit der Studierenden im Verlauf des Studiums, abhängig vom Studienfach?
Die Ergebnisse zeigen, dass es signifikante Unterschiede in der Gesundheit von Studierenden je nach Studienfach gibt. So berichten Studierende der Medizin und Gesundheitswissenschaften durchweg von einer guten Gesundheit im ersten sowie im letzten Jahr ihres Studiums. Dies könnte darauf zurückzuführen sein, dass in diesen Fächern gesundheitsrelevantes Wissen vermittelt wird, was möglicherweise zu einem insgesamt gesünderen Lebensstil führt. Auf der anderen Seite beginnen Jurastudierende ihr Studium mit den höchsten Gesundheitswerten, jedoch erleben sie im Verlauf des Studiums den stärksten Rückgang. Dies könnte mit dem hohen Stressniveau und den strengen Anforderungen in diesem Fach zusammenhängen. Studierende der Geisteswissenschaften und der Künste zeigen zu Beginn ihres Studiums die niedrigsten Gesundheitswerte. Allerdings scheint das Studienfach selbst keine weiteren negativen Auswirkungen auf ihre Gesundheit zu haben. Im Gegenteil: Ihr Gesundheitsverlauf war überdurchschnittlich gut.

Gesundheit und Studienfach: Henne oder Ei?
Reuter stellt unterschiedliche Mechanismen vor, wie das Studienfach die Gesundheit beeinflussen könnte – und umgekehrt. Beispielsweise gilt Jura als besonders leistungsorientiert und wettbewerbsintensiv und ist für hohe Durchfallquoten und den damit verbundenen Stress bekannt. Dagegen vermitteln Fächer wie Medizin oder Sport gesundheitsrelevantes Wissen, was zu einem höheren Gesundheitsbewusstsein und gesünderen Lebensstil führen könnte. Reuter hebt hervor, dass Belastungen im Studium nicht nur psychischer Natur sind, sondern sich auch auf die körperliche Gesundheit auswirken können. Er verweist auf Fälle von Autoimmunerkrankungen und Allergien, die im Falle von chronischem Stress auftreten können. Diese Beobachtungen lassen darauf schließen, dass der hohe Druck und die ständigen Anforderungen in solchen Fächern eine signifikante Rolle bei der Entstehung gesundheitlicher Probleme spielen können.
Der Soziologe stellt jedoch auch die Frage, ob nicht die Studienwahl selbst auf bereits bestehende Unterschiede in der sozialen Herkunft hinweist. Studierende aus bildungsnahen und wohlhabenden Familien wählen häufiger Fächer wie Jura oder Medizin, während Studierende aus weniger privilegierten Verhältnissen häufiger geistes- und sozialwissenschaftliche Fächer belegen. Diese Unterschiede in der sozialen Herkunft haben ebenfalls Auswirkungen auf die gesundheitlichen Ressourcen, die den Studierenden zur Verfügung stehen. Studierende aus einkommensstarken Familien haben oft besseren Zugang zu medizinischer Versorgung und psychologischer Unterstützung, was ihre Fähigkeit verbessert, mit dem Stress umzugehen. Gleichzeitig, so Reuter, können die gesundheitlichen Unterschiede zwischen den Studienfächern langfristig auch die sozialen Ungleichheiten verstärken. Studierende, die während ihres Studiums gesundheitliche Probleme entwickeln, haben oft schlechtere Chancen auf dem Arbeitsmarkt, was ihre berufliche und finanzielle Zukunft negativ beeinflusst. Dies gilt insbesondere für Studierende aus einkommensschwächeren Familien, die ohnehin weniger Ressourcen zur Verfügung haben, um mit den gesundheitlichen Herausforderungen umzugehen.
Wie Uni-Stress Körper und Geist formt
Soziologie stelle erst einmal nur das Wissen zur Verfügung, so Reuter. Dieses könnte jedoch von Entscheidungsträgern genutzt werden. Betrachtet man die Studienfächer, die die Studierenden sehr stark belasten, lässt sich feststellen: Jura hat ein Prüfungssystem, das auf große Staatsexamina am Ende des Studiums fokussiert. „Das fördert ‚Bulimie-Lernen‘ und führt zu enormem Stress, in kurzer Zeit eine große Menge an Wissen zu lernen, um es in einer Abschlussprüfung wiederzugeben.“ Viele andere Studiengänge nutzen dagegen kleinere Prüfungen während des Studiums. Damit könnten einige Studierende außerdem frühzeitig feststellen, dass ihnen ein bestimmtes Fach nicht liegt oder sie es nicht schaffen. Sie könnten oder müssten sogar früher abbrechen, anstatt nach fünf Jahren intensiven Studiums alles auf eine abschließende Prüfung zu setzen. „Das Commitment, das diese Studierenden aktuell eingehen, ist wahnsinnig hoch: Nach fünf Jahren Studium steht alles auf dem Spiel.“
Was für die Gesundheit der Gesellschaft insgesamt konkret getan werden könne, bei dieser Frage ist Reuter dagegen zurückhaltender. Viele Vorschläge gingen zu schnell in Richtung Aufklärungskampagnen – die jedoch nicht immer den gewünschten Effekt brächten. „Stattdessen plädiere ich dafür, die ökonomischen Bedingungen zu verbessern“, so Reuter. Zukünftig möchten er und sein Kollege Matthias Dütsch, Professor für Soziologie, insbesondere Arbeitsforschung, an der Universität Bamberg, beispielsweise untersuchen, ob und wie stark auch politische Maßnahmen wie Mindestlöhne dazu beitragen, die Gesundheit von Menschen zu verbessern, indem sie die Lebensbedingungen stabilisieren und den Zugang zu gesunden Lebensmitteln und Wohnraum erleichtern. „Wenn wir möchten, dass Menschen länger arbeiten und dabei gesund bleiben, müssen wir ihre sozialen und wirtschaftlichen Lebensbedingungen verbessern“, fordert Reuter. Die Stellschrauben dazu kann er identifizieren – und gibt damit auch wirtschaftlich benachteiligten Personengruppen eine Stimme.
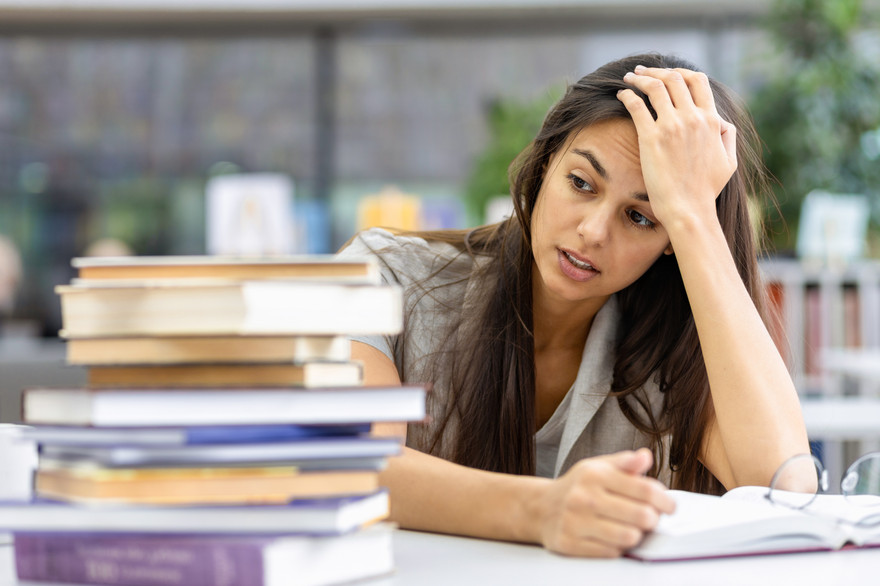
Weitere Informationen
Die Studie A longitudinal analysis of health inequalities from adolescence to young adulthood and their underlying causes finden Sie als Volltext unter