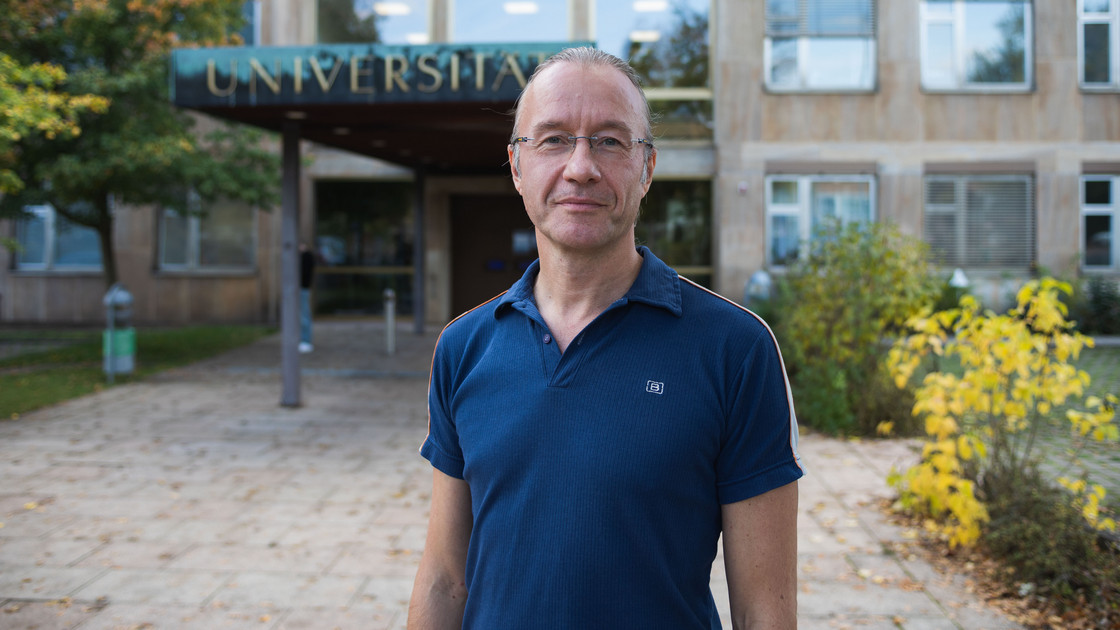Von Rostock nach Bamberg: Einmal quer durch Deutschland ist Prof. Dr. Rasmus Hoffmann für seine neue Stelle gezogen. Seit 1. September 2021 ist er der Nachfolger von Prof. Dr. Dr. Hans-Peter Blossfeld auf dem Lehrstuhl für Soziologie I, nach seiner Emeritierung umbenannt in Lehrstuhl für Soziologie, insbesondere Soziale Ungleichheit. Warum Rasmus Hoffmann als Soziologe zum Thema Gesundheit forscht und es ihm wichtig ist, sich für die Gesellschaft zu engagieren, erzählt er im Interview.
Warum haben Sie sich für eine wissenschaftliche Karriere entschieden?
Rasmus Hoffmann: Am Beruf des Wissenschaftlers gefällt mir besonders, dass wir die Freiheit haben, interessengeleitet arbeiten zu können. Bereits mein Studium empfand ich als Privileg: Ich konnte meine Fächerkombination Soziologie, Biologie und Französisch ganz nach meinen persönlichen Vorlieben auswählen, meine Schwerpunkte entsprechend setzen und mich darauf ausgerichtet weiterentwickeln. Auf dieser Basis war der Weg in die Wissenschaft für mich ein konsequenter nächster Schritt. Ich habe mich zwar immer wieder auch für andere Berufe interessiert, aber einen ernsthaften Plan B gab es nie.
Sie forschen zu sozialer Ungleichheit, speziell im Bereich Gesundheit. Wie kam es dazu?
Ich habe am Max-Planck-Institut für Demografische Forschung in Rostock zu sozioökonomischen Unterschieden in der Alterssterblichkeit in Dänemark und den USA promoviert. Dabei habe ich untersucht, welche sozialen und wirtschaftlichen Faktoren die Lebenserwartung von Menschen beeinflussen. Die Zusammenhänge zwischen Gesundheit und sozialer Ungleichheit haben mich sehr interessiert und ich wollte diese Verbindungen besser verstehen.
Die Themen Gesundheit und soziale Ungleichheit sind beide sehr komplex.
Wo genau verorten Sie sich da?
Nach meiner Dissertation am Max-Planck-Institut habe ich unter anderem im Erasmus Medical Center in Rotterdam im Bereich Public Health geforscht, also in einem anwendungsbezogenen Fachgebiet, das sich mit der Gesundheit der Bevölkerung, insbesondere mit der Vorbeugung von Krankheiten, Förderung der Gesundheit und mit gesundheitlicher Ungleichheit beschäftigt. Neben Soziologie und Demografie war Public Health der dritte fachliche Baustein, der mir geholfen hat, das Thema Gesundheit zu erschließen. In meinem ERC-Projekt am Europäischen Hochschulinstitut in Florenz habe ich dann intensiv an diesen Schnittstellen weiter geforscht.
Das von Ihnen angesprochene Forschungsprojekt ist vom European Research Council (ERC) mit knapp 1 Million Euro gefördert worden. Um was ging es in diesem Projekt?
Menschen mit geringerem Einkommen oder niedrigerem Bildungsniveau haben einen schlechteren Gesundheitszustand und eine höhere Sterblichkeit. Das Projekt hat sich unter Berücksichtigung des Lebensverlaufs mit zwei wichtigen Fragen befasst, die dieser sozialwissenschaftlich gesicherten Erkenntnis zugrunde liegen: Wie bestimmt der sozioökonomische Status die Gesundheit? Und wie bestimmt die Gesundheit den sozioökonomischen Status? Also sehr vereinfacht gesagt: Ist man arm, weil man krank ist oder krank, weil man arm ist?
Haben Sie angesichts dieser aktuellen Themen auch den Anspruch entwickelt, mit Ihrer Forschung positiv in die Gesellschaft wirken zu wollen?
Ja, den gibt es durchaus, obwohl man natürlich realistisch sein muss. Wissenschaftliche Erkenntnisse zu generieren bedeutet nicht automatisch die Welt zu verändern. Entscheidend ist, dass Gesellschaft und Politik diese Erkenntnisse aufgreifen und ihr Handeln danach ausrichten. Interdisziplinäre Forschung an der Schnittstelle zwischen Sozialwissenschaften und Medizin kann dafür viele Impulse liefern – und sollte dies aus meiner Sicht auch tun. In der aktuellen Ausgabe von uni.vers, dem Forschungsmagazin der Universität Bamberg, stelle ich zum Beispiel einige Ansatzpunkte vor. Nicht nur ich, sondern auch die wissenschaftliche Community, die gesundheitliche Ungleichheit erforscht, hat sich in den letzten Jahrzehnten von der Beschreibung, über die Erklärung, hin zu einer Forschung entwickelt, die Interventionsmöglichkeiten entwickelt und evaluiert. Gerade der Bereich Public Health, der explizit das Ziel verfolgt, Bedingungen zu schaffen und sicherzustellen, unter denen Menschen gesund leben können, bietet gute politische Interventionsmöglichkeiten.
Welche Anknüpfungspunkte sehen Sie für Ihre Arbeit an der Universität Bamberg?
Soziale Ungleichheit ist ein unglaublich facettenreiches und vielschichtiges Thema. Armut, Bildung, Verhalten, soziale Milieus oder auch Pandemien wie Corona lassen sich unter diesem Aspekt analysieren. Insofern kann ich mir mit vielen Fächern und Fachbereichen eine Zusammenarbeit vorstellen, zum Beispiel mit der Politikwissenschaft. Aktuell erforschen wir am Lehrstuhl die Zusammenhänge zwischen Parteizugehörigkeit und Impfbereitschaft.
In der Lehre möchte ich mich auch dem Klimawandel und seinen sozialen Ursachen und Folgen sowie der Frage widmen, wie unsere Gesellschaft mit Natur umgeht. Gemeinsam mit Studierenden könnten wir zum Beispiel herausarbeiten, inwieweit das Konsumverhalten und der Lebensstil von Menschen verschiedener sozialer Schichten zum Klimawandel beitragen, wo demzufolge Verantwortlichkeiten liegen und warum kaum Verhaltensänderungen erfolgen. Die Themen Gesundheit und Umweltschutz sind übrigens vergleichbar, weil es sich in beiden Fällen um komplexe Verhältnisse zwischen Gesellschaft und Natur handelt. Der große Unterschied ist, dass wir unsere Gesundheit in den letzten Jahrzehnten stark verbessert haben, während wir gleichzeitig die Umwelt zerstören und damit bewusst auf soziale und gesundheitliche Katastrophen zusteuern.
Bleiben wir beim Thema Lehre. Auf was legen Sie in diesem Bereich wert?
Ich würde die Studierenden gerne dazu ermuntern, sich der Freiheiten, die ihnen das Studium gibt, bewusst zu werden und diese zu nutzen. Freiheit geht immer mit Verantwortung einher, auch das ist ein Aspekt, den ich vermitteln möchte. Im Studium kann das bedeuten, dass ich Verantwortung für mich selbst übernehme – aber auch für die Gesellschaft.
Was heißt das konkret?
Verantwortung für sich selbst übernehmen heißt zum Beispiel, dass ich mich mit meinen Fähigkeiten, Stärken und Schwächen konstruktiv auseinandersetze und mich entsprechend weiterentwickle. Neues ausprobieren, für seine Ideen einstehen, sich Ziele setzen, mit Rückschlägen umgehen: Solche Lernprozesse sind nicht einfach, aber wichtig, wenn ein Studium mehr sein soll als eine Berufsausbildung.
Verantwortung für die Gesellschaft kann bedeuten, das erworbene Fachwissen zu nutzen, um Zustände, Ereignisse oder Situationen kritisch zu hinterfragen, Lösungsansätze zu entwickeln und sich für deren Umsetzung zu engagieren. Dafür sind Kenntnisse und Kompetenzen auf hohem Niveau gefragt, deshalb möchte ich die Studierenden dazu motivieren und anleiten, ihre Leistungsgrenzen auszuschöpfen.
Wie ist Ihr Fazit bislang: Hat sich der Umzug von der Ostsee ins fränkische Rom gelohnt?
Ich würde sagen ja. Ich schätze das Interesse und die Offenheit, die die Universität Bamberg meiner Arbeit entgegenbringt. Als Soziologe seinen Fokus auf den Bereich Gesundheit zu legen, ist nicht üblich. Ich hatte hier von Anfang an das Gefühl, dass diese ungewöhnliche Ausrichtung gewünscht ist und unterstützt wird. Ich fühle mich in Bamberg sehr wohl, und ich freue mich schon darauf, auch kulturell mehr teilzunehmen. Zum Beispiel würde ich im Bereich Hochschulsport gerne einen Karatekurs anbieten oder an dieser Universität mit so vielen Ensembles und einem reichhaltigen musikalischen Angebot mit anderen Musik machen. Seit ich Professor bin, spiele ich zwar nicht mehr so intensiv Klavier wie vorher, hätte aber große Lust, den Faden wiederaufzunehmen. Beim Lehrstuhl für Musikpädagogik und Musikdidaktik habe ich schon Interesse bekundet und es wäre schön, wenn ich mich anderen Musikbegeisterten anschließen könnte.
Vielen Dank für das Interview!